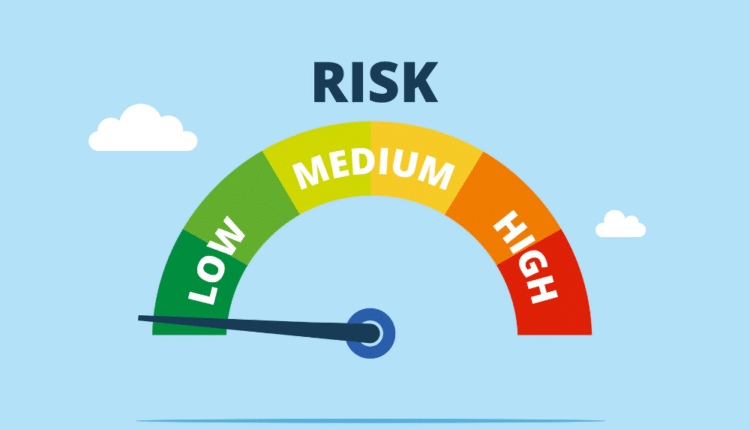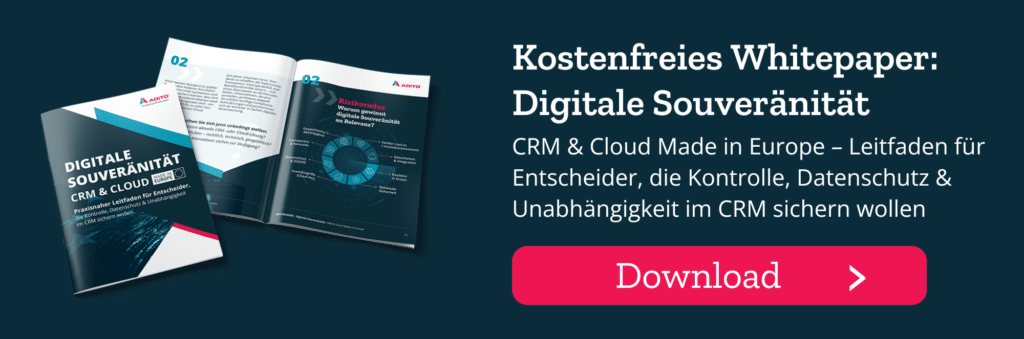In einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt müssen sich Unternehmen immer mehr auf externe Dienstleister, Lieferanten und Technologiepartner verlassen können. Vendor Risk Management befasst sich mit den Risiken, die damit einhergehen. Denn die Zusammenarbeit bringt zwar von Effizienzsteigerungen bis hin zu Kosteneinsparungen zahlreiche Vorteile, ist jedoch nicht immer risikofrei.
Inhalt
Was ist Vendor Risk Management (VRM)?
Vendor Risk Management (VRM) oder auch Lieferanten-Risikomanagement bezeichnet den systematischen Prozess zur Identifizierung, Bewertung und Kontrolle von Risiken, die durch die Zusammenarbeit mit Drittanbietern entstehen können. Ziel ist es, potenzielle Bedrohungen für das eigene Unternehmen frühzeitig zu erkennen und diese zu minimieren.
Was sind Risiken in der Zusammenarbeit mit Drittanbietern?
Vielen Unternehmen sind die Risiken, die durch die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, Lieferanten und Technologiepartnern oder anderen Drittanbietern entstehen gar nicht so stark bewusst. Diese sind vielfältig und je nach Branchen und Produkten teilweise stärker oder weniger stark zu berücksichtigen:
Informationssicherheits- und Datenschutzrisiken
Datenlecks oder -verlust: Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen beim Drittanbieter können zum Verlust sensibler Daten führen.
Cyberangriffe: Anbieter könnten Opfer von Ransomware, Phishing oder anderen Angriffen werden, was sich auf Sie als Auftraggeber auswirken kann.
Nichtkonformität mit Datenschutzgesetzen (z. B. DSGVO): Der Anbieter verarbeitet personenbezogene Daten nicht nach geltenden Vorschriften.
Operative Risiken
Leistungsstörungen oder Ausfälle: Der Anbieter kann seine Services nicht wie vereinbart liefern, was zu Lieferverzögerungen oder Produktionsstillständen führt.
Mangelhafte Qualität: Gelieferte Produkte oder Dienstleistungen entsprechen nicht den vereinbarten Standards – oft ist dies nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
Abhängigkeit von Einzelanbietern (Single Source): Wenn nur ein Anbieter verfügbar ist, kann dies bei Ausfällen gravierende Folgen haben.
Finanzielle Risiken
Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz: Der Anbieter gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten, was laufende Projekte gefährden kann.
Versteckte Kosten oder Preisänderungen: Unerwartete Preissteigerungen oder undurchsichtige Kostenstrukturen.
Rechtliche und regulatorische Risiken
Verstöße gegen gesetzliche oder regulatorische Vorgaben: Der Anbieter hält z. B. Umwelt-, Arbeits- oder Sicherheitsvorschriften nicht ein.
Vertragsverstöße: Nicht-Einhaltung von SLA-Vereinbarungen, Kündigungsfristen oder Lizenzbedingungen.
Reputationsrisiken
Skandale oder ethisches Fehlverhalten des Anbieters: Kinderarbeit, Umweltvergehen oder Korruption strahlen negativ auf den Auftraggeber ab.
Negative Medienberichterstattung: Schlechte Presse über einen Partner kann auch dem eigenen Unternehmen schaden.
Geopolitische und länderspezifische Risiken
Politische Instabilität: Lieferanten in Krisenregionen können ausfallen.
Handelsbarrieren oder Sanktionen: Export-/Importbeschränkungen oder Sanktionen gegen bestimmte Länder oder Firmen. Beziehungsweise auch ausgehend von anderen Ländern wie kürzlich von den USA.
Nachhaltigkeits- und ESG-Risiken
Nichtbeachtung von ESG-Kriterien: Anbieter, die Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekte nicht erfüllen, können ESG-Ziele des Unternehmens gefährden.
Was bedeutet ESG?
ESG steht für Environmental Social Governance – auf Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Es bezieht sich auf Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen. Seit dem 1. Januar 2023 gilt das europäische ESG-Gesetz für in Deutschland ansässige Unternehmen mit mind. 3000 Beschäftigen. Viele Unternehmen beschäftigen sich jedoch aus eigenem Antrieb mit ESG. Laut einer Studie von Friede, Busch und Bassen besteht in 90 % der Fälle eine positive Korrelation zwischen ESG-Leistung und finanziellen Ergebnissen. Firmen, die hohe ESG-Anforderungen erfüllen, zeigen typischerweise ein reduziertes Risikoprofil.
Warum ist VRM wichtig?
Ein strukturiertes Lieferanten-Risikomanagement sorgt dafür, dass potenzielle Risiken, die durch Drittanbieter entstehen, frühzeitig erkannt und bewertet werden können, um angemessen zu reagieren. Ohne ein effektives Risikomanagement kann ein einzelner Vorfall bei einem Lieferanten weitreichende Auswirkungen auf das eigene Unternehmen haben – von Reputationsschäden über regulatorische Konsequenzen bis hin zu wirtschaftlichen Verlusten. Die Bedeutung von Vendor Risk Management nimmt aus folgenden Gründen stetig zu:
Zunahme externer Dienstleister
In unserer zunehmend vernetzten Geschäftswelt müssen sich Unternehmen auch immer stärker auf externe Partner verlassen. Das reicht von IT-Dienstleistungen und Cloud-Anbietern, über die Logistik bis hin zur Herstellung von Waren im Ausland. Diese Entwicklung bringt jedoch nicht nur Effizienzgewinne, sondern schafft Abhängigkeiten. Jeder zusätzliche Dienstleister erhöht potenzielle Risiken.
Strengere regulatorische Anforderungen
Branchenübergreifend verschärfen sich die gesetzlichen Vorgaben, etwa durch DSGVO, die europäische NIS2 Cyber Security Richtlinie oder ISO-Normen. Die Nichtbeachtung gesetzlicher Vorgaben durch Dritte, etwa im Bereich Datenschutz oder Nachhaltigkeit, kann unmittelbar auf das beauftragende Unternehmen zurückfallen. Darüber hinaus fordern Regulierungsbehörden zunehmend transparente und nachvollziehbare Prozesse im Umgang mit Drittanbietern – insbesondere in kritischen Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen oder kritischer Infrastruktur. VRM ist daher nicht nur ein betriebswirtschaftliches Muss, sondern auch ein zentraler Baustein für regulatorische Compliance.
Was ist die europäische NIS2 Cyber Security Richtlinie?
Die europäische NIS2-Richtlinie verpflichtet mittelgroße und große Unternehmen, in bestimmten kritischen oder wichtigen Sektoren, umfassende Cyber-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, Vorfälle binnen 24 Stunden zu melden und ihre IT-Risiken systematisch zu managen. Sie soll das Cybersicherheitsniveau in der EU vereinheitlichen und erhöht die Verantwortung der Unternehmensleitung bei Verstößen deutlich.
Cybersecurity-Bedrohungen
Sogenannte „Supply Chain Attacks“ also Angriffe auf Lieferketten – nehmen zu. Angreifer suchen dabei nach Schwachstellen in Code, Infrastruktur oder Netzwerken, die es ihnen ermöglichen schädliche Komponenten einzuschleusen. Die Angreifer müssen oft nur ein einziges Glied in der Lieferkette finden, um potenziellen Zugriff auf tausende Opfer zu erhalten. Datenpannen bei externen IT-Dienstleistern können zu massiven Bußgeldern und Vertrauensverlust führen.
Reputationsrisiken
Ein Fehler beim Partner kann schnell auf das eigene Unternehmen zurückfallen – sei es durch Datenschutzverletzungen oder ethisches Fehlverhalten. Beispielsweise gefährden Produktionsstillstände aufgrund insolventer Zulieferer die Lieferfähigkeit und damit die Kundenbeziehungen, obwohl das Unternehmen dies nicht selbst in der Hand hat.
Vendor Risk Management ist somit weit mehr als ein Kontrollinstrument – es ist ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmensführung, der Resilienz, Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit stärkt.
VRM – Herausforderungen und Lösungen
Strukturiertes Vendor Risk Management ist nicht immer einfach. Hier sind einige der größten Herausforderungen sowie Lösungsansätze für Sie zusammengefasst:
1. Mangelnde Transparenz über Drittanbieter und Subdienstleister
Herausforderung: Viele Unternehmen wissen nicht genau, welche Daten, Prozesse oder Systeme durch Drittanbieter – oder gegebenenfalls deren Subunternehmer – genutzt werden. Das erschwert die Risikobewertung erheblich.
Lösung: Volle Transparenz ist nicht bei jedem Anbieter möglich. Schon bei der Auswahl Ihrer Lieferanten sollten Sie auf transparente Kommunikation achten. Hilfreich ist die Einführung eines zentralen Drittanbieterverzeichnisses z.B. in einer CRM- oder SRM-Lösung, in dem alle relevanten Beziehungen dokumentiert sind.
Was ist eine CRM-Lösung?
Eine CRM-Lösung (Customer-Relationship-Management) ist eine Software, die Unternehmen hilft, ihre Beziehungen zu Kunden zu verwalten. Sie speichert Informationen über Kunden, unterstützt bei der Kommunikation und hilft, Verkaufsprozesse und Kundenservice zu verbessern.
Was ist eine SRM-Lösung?
Eine SRM-Lösung (Supplier-Relationship-Management) ist eine Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Beziehungen zu Lieferanten zu verwalten. Sie hilft, Informationen über Lieferanten zu organisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und Einkaufsprozesse effizienter zu gestalten. Zudem unterstützt sie das Vendor-Risk-Management, indem sie potenzielle Lieferengpässe, Abhängigkeiten oder Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig erkennt.
2. Fehlende Standardisierung und Prozesse
Herausforderung: VRM-Prozesse sind oft inkonsistent, manuell und von Abteilungen abhängig, wodurch Risiken übersehen oder Lieferanten nicht vergleichbar bewertet werden.
Lösung: Aufbau eines unternehmensweiten, standardisierten VRM-Prozesses – idealerweise unterstützt durch digitale Tools wie einer Supplier-Relationshipmanagement (SRM)-Lösung, in der Risikobewertungen durchgeführt sowie Fragebögen, Vertragsdaten und Monitoring zentral verwaltet werden.
3. Unzureichende Risikoanalysen und Bewertungskompetenz
Herausforderung: Fachabteilungen fehlt oft das Know-how, um Risiken (z. B. Cybersecurity oder ESG) systematisch zu analysieren oder zu priorisieren.
Lösung: Schulung relevanter Stakeholder und Einbindung von Fachkräften aus IT-Sicherheit, Datenschutz, Recht und Compliance. Nutzung etablierter Bewertungsframeworks (z. B. NIST, ISO 27001) hilft bei der Vergleichbarkeit.
4. Fehlendes kontinuierliches Monitoring
Herausforderung: Viele Unternehmen führen nur zu Beginn der Partnerschaft eine Risikobewertung durch – Veränderungen beim Anbieter bleiben danach unbemerkt.
Lösung: Implementierung eines kontinuierlichen Monitorings mit regelmäßigen Audits, Risiko-Reviews und automatisierten Frühwarnsystemen (z. B. zu Cybervorfällen oder Finanzdaten). Auch hier kann eine SRM-Lösung hilfreich sein.
5. Schnittstellenprobleme zwischen Fachbereichen
Herausforderung: Verantwortung für das Vendor-Risk-Management ist oft unklar verteilt. Während Einkauf, IT, Compliance oder Legal jeweils eigene Teilansichten haben, fehlt die ganzheitliche Steuerung.
Lösung: Etablierung einer zentralen Koordinationsstelle oder einer zentralen Software-Lösung, in der alle Risikobewertungen zentral zusammenlaufen und für alle Abteilungen einsehbar sind.
6. Zu hohe Abhängigkeit von kritischen Lieferanten
Herausforderung: Gerade bei Schlüsseltechnologien oder Rohstoffen bestehen häufig kaum Alternativen, was das Risiko im Ernstfall massiv erhöht.
Lösung: Aufbau einer Diversifizierungsstrategie, Notfallpläne, Exit-Szenarien und das regelmäßige Bewerten von Konzentrationsrisiken.
Reaktive statt proaktive Risikosteuerung
Herausforderung: Oft wird das Lieferantenrisikomanagement nicht proaktiv regelmäßig in Unternehmen durchgeführt, sondern erst reagiert, wenn Informationen zufällig entdeckt oder öffentlich gemacht werden.
Lösung: Regelmäßig proaktive Überprüfung der Lieferanten und anderer Drittanbieter.
Software für Vendor Risk Management
Ein effektives Vendor Risk Management (VRM) funktioniert nur mit systematischem, kontinuierlichem und transparentem Controlling der Risiken entlang der Lieferkette. Dabei stoßen manuelle Prozesse schnell an ihre Grenzen – sei es durch eine steigende Anzahl an Lieferanten, zunehmende regulatorische Anforderungen oder die Komplexität globaler Liefernetzwerke. Spezialisierte Software gewinnt deshalb an Bedeutung. Insbesondere SRM-Systeme spielen eine zentrale Rolle, um Risikomanagementprozesse effizient, skalierbar und nachvollziehbar zu gestalten:
1. Zentrale Erfassung und Bewertung von Risiken im SRM
Ein SRM-System dient nicht nur als digitales Lieferantenverzeichnis, sondern als zentrales Steuerungsinstrument für das gesamte Lieferantenmanagement. Im Kontext des Vendor Risk Managements ermöglicht es:
- Systematische Erfassung risikorelevanter Informationen wie Zertifikate, Auditberichte, Finanzkennzahlen, Cybersecurity-Standards oder ESG-Daten.
- Automatisierte Risikobewertung auf Basis individuell konfigurierbarer Kriterien und Risikokategorien (z. Compliance, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit/ESG).
- Transparente Klassifizierung von Lieferanten nach Risikoprofilen
2. Automatisierte Workflows und Eskalationsmechanismen
Moderne SRM-Lösungen bieten automatisierte Workflows für:
- Due Diligence-Prozesse bei der Auswahl neuer Lieferanten.
- Regelmäßige Assessments zur Aktualisierung der Risikobewertung.
- Eskalationsmechanismen, falls bestimmte Risiken einen Schwellenwert überschreiten oder Dokumente verfallen (z. abgelaufene Zertifizierungen).
3. Integration externer Datenquellen
SRM-Systeme lassen sich mit externen Datenquellen verbinden, etwa zur Überwachung von:
- Finanzdaten (z. Bonitätsprüfungen durch Creditreform oder Dun & Bradstreet),
- Compliance-Screenings (Sanktionslisten, Watchlists),
- Cybersecurity-Ratings,
- Nachrichten-Feeds zu politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen.
4. Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Dokumentationspflicht im Rahmen regulatorischer Anforderungen (z. B. DSGVO, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG, ISO 27001).
SRM-Software bietet hier:
- Zentrale Ablage aller risikorelevanten Dokumente,
- Audit-Trails zur Nachverfolgbarkeit von Entscheidungen,
- Berichtsfunktionen für interne Audits oder Prüfungen durch Behörden.
5. Förderung von Zusammenarbeit und Transparenz
Ein weiterer Vorteil: SRM-Systeme fördern die interne Zusammenarbeit. Statt Informationen dezentral in Excel-Tabellen, E-Mails oder verschiedenen Abteilungen zu verstreuen, bündelt ein SRM-Tool sämtliche risikorelevanten Daten an einem Ort.
Der Vendor-Risk-Management Prozess
5 Phasen der Risikomanagementprozesses
Im Allgemeinen unterteilt sich der Risikomanagementprozess in folgenden 5 Phasen:
- Risiko identifizieren
- Risiko analysieren
- Risiko priorisieren
- Risiko behandeln
- Risiko überwachen
Der Risikomanagement-Prozess
Ein effektiver VRM-Prozess besteht typischerweise aus folgenden Kernkomponenten:
1. Identifikation von Drittanbietern
Der erste Schritt im VRM-Prozess ist die Identifikation und zentrale Erfassung aller relevanten Lieferanten, Partner oder Dienstleister. Dabei werden nicht nur direkte Zulieferer betrachtet, sondern auch Subunternehmer, IT-Dienstleister oder Berater – je nachdem, inwiefern sie für das Unternehmen risikorelevant sind.
In der Praxis erfolgt zudem eine Kategorisierung, etwa nach:
- Kritikalität für das eigene Geschäft (z. B. strategischer Lieferant, Single Source?),
- Art der gelieferten Leistung (Waren, IT-Dienstleistung, Logistik, Beratung etc.),
- Regionale Risiken (z. B. Standort in politisch instabilen Ländern),
- Sensibilität der ausgetauschten Daten (z. B. Zugriff auf Kundendaten, Produktionssysteme).
- Diese Einstufung bildet die Basis für weitere Schritte im Prozess.
2. Risikobewertung und Due Diligence
Anhand der zuvor bestimmten Risikokategorie wird eine erste Risikobewertung durchgeführt. Diese besteht aus einem strukturierten Fragebogen, aus dem Einholen von Nachweisen (z. B. ISO-Zertifikate, Versicherungspolicen, Nachhaltigkeitsberichte) und gegebenenfalls aus automatisiert erhobenen Daten. Auf Basis eines gewichteten Scoring-Modells ergibt sich dann ein Risikoprofil. Je nach Risikokategorie muss der Lieferant genauer geprüft oder kann im nächsten Schritt freigegeben werden.
3. Freigabe und Integration
Nach abgeschlossener Prüfung wird über die Freigabe des Lieferanten entschieden. Bei unkritischen Lieferanten kann dies zügig erfolgen, während bei erhöhtem Risiko oft zusätzliche Maßnahmen notwendig sind – z. B. vertragliche Sicherheiten, spezifische Auditauflagen oder technische Zugriffsbeschränkungen.
4. Vertragliche Absicherung
Verträge sollten klare Regelungen zu Datenschutz, Sicherheitsstandards, Haftung und Kontrollrechten enthalten. Auch Exit-Strategien sind Teil eines guten Vertragsmanagements.
5. Monitoring und Reporting
Risiken sind dynamisch. Sie können schleichend oder plötzlich auftreten. Deshalb ist eine kontinuierliche Überwachung der Anbieter notwendig – zum Beispiel durch automatisierte Tools, regelmäßige Risikoanalysen und Lieferantenbewertungen.
6. Notfall- und Eskalationspläne
Für den Ernstfall braucht es klare Prozesse, etwa bei Datenpannen oder Ausfällen. Wer wird informiert? Wer ist verantwortlich? Wie schnell muss reagiert werden?
Fazit: Proaktiv statt reaktiv handeln
Vendor Risk Management ist Pflicht – insbesondere für Unternehmen, die auf komplexe Lieferketten oder cloudbasierte IT-Services angewiesen sind. Ein proaktives, systematisches VRM schützt zum einen finanziellen und Reputationsschäden und stärkt das Vertrauen von Kunden, Partnern und Regulierungsbehörden. Unternehmen, die Risiken früh erkennen und strukturiert managen, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.