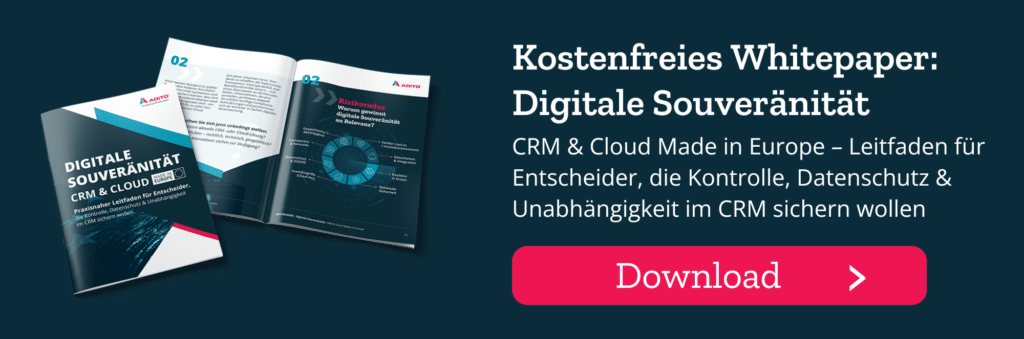Digitale Souveränität (Digital Sovereignty) ist für Unternehmen in Zeiten fortschreitender Digitalisierung von zentraler Bedeutung. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie importieren 96 Prozent der deutschen Unternehmen digitale Technologien und Services aus dem Ausland. Diese einseitige Abhängigkeit gefährdet nicht nur die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die technologische Selbstbestimmung Deutschlands. Die Digitalisierung bietet zahlreiche Vorteile – etwa Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sowie die Erschließung neuer wirtschaftlicher Potenziale – doch sie geht auch mit Herausforderungen einher.
Eine zentrale Herausforderung besteht in der zunehmenden Abhängigkeit von spezialisierten externen Anbietern für essenzielle Dienstleistungen wie Cloud-Hosting, Datenanalyse und IT-Sicherheit. Firmen müssen oft darauf vertrauen, dass diese Dienstleister zuverlässig agieren und verantwortungsvoll mit sensiblen Daten umgehen. Genau hier wird die Bedeutung digitaler Souveränität besonders deutlich.
Inhalt
Digitale Souveränität – Definition
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit und Möglichkeit, im digitalen Raum autonom zu handeln und digitale Technologien sowie IT-Infrastrukturen selbstbestimmt zu gestalten. Sie umfasst zudem die volle Kontrolle über eigene und anvertraute Daten. Grundsätzlich können sowohl Individuen als auch Institutionen digital souverän sein.
Warum sollten Unternehmen digital souverän sein?
In einer zunehmend digitalisierten Welt ist die Frage, wer über unsere Daten, unsere Infrastruktur und unsere digitalen Werkzeuge die Kontrolle hat, keine rein technische Frage mehr. Besonders für deutsche Betriebe rückt das Thema digitale Souveränität auch aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen immer stärker in den Fokus. Geopolitische und regulatorische Rahmenbedingungen haben sich in letzter Zeit spürbar verschärft.
Digital souverän zu sein bedeutet nämlich nicht nur Kontrolle über eigene Daten und Systeme, sondern auch Resilienz gegenüber geopolitischen Spannungen, Lieferkettenrisiken und Abhängigkeiten von einzelnen globalen IT-Anbietern. Wer unabhängig agieren kann, ist besser geschützt vor Ausfällen, Datenschutzverletzungen oder einseitigen Änderungen von Dienstleistungsbedingungen. Die Souveränität bietet noch weitere Vorteile:
Schutz sensibler Daten
Je nach Branche arbeiten Unternehmen mit einer Vielzahl sensibler Daten – von Kundendaten bis hin zu innovationsrelevanten Informationen. Wer auf ausländische Cloud-Dienste oder IT-Infrastrukturen angewiesen ist, gibt einen Teil der Kontrolle über seine Daten aus der Hand. Besser ist es, selbst zu bestimmen, wie und wo Ihre Daten verarbeitet und gespeichert werden – ein entscheidender Vorteil im Zeitalter von Cyberangriffen, Wirtschaftsspionage und immer komplexeren Datenschutzanforderungen.
Weniger Abhängigkeiten und Risikominimierung
Viele digitale Geschäftsprozesse hängen heute von einer kleinen Zahl internationaler Technologieanbieter ab. Insbesondere bei Software vertrauen deutsche Betriebe häufig auf amerikanische Software-Giganten. Doch das birgt Risiken: Preiserhöhungen, plötzliche Änderungen der Nutzungsbedingungen, politische Sanktionen oder die Einstellung von Services können die Geschäftskontinuität gefährden. Digitale Souveränität bedeutet, sich technologische Alternativen zu schaffen, um sich nicht abhängig oder gar erpressbar zu machen.
Stärkung der Resilienz und Krisenfestigkeit
Die jüngsten globalen Krisen – von der Corona-Pandemie bis hin zu geopolitischen Spannungen zuletzt durch die USA – haben gezeigt, wie verletzlich globale Liefer- und Technologieketten sein können. Unternehmen, die auf eigene oder europäische digitale Infrastrukturen zurückgreifen können, sind besser gegen externe Überraschungen gewappnet und können flexibler reagieren. Digitale Souveränität wird damit zu einem wichtigen Element unternehmerischer Resilienz.
Rechtssicherheit und regulatorische Konformität
Durch europäische Vorgaben wie die DSGVO, EU-Datenschutzregeln sowie den ergänzenden EU Data Act wird der Rechtsrahmen für den Umgang mit digitalen Daten komplexer. Firmen, die ihre digitalen Systeme und Datenflüsse selbst gestalten und kontrollieren, können regulatorische Anforderungen besser erfüllen und Risiken minimieren. Digitale Souveränität erleichtert die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften – national und international.
Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
Digitale Souveränität schafft die Grundlage für eine unabhängige und strategische Nutzung neuer Technologien – von künstlicher Intelligenz bis hin zu Industrie 4.0. Wer eigene digitale Infrastrukturen und Plattformen kontrolliert, kann schneller und gezielter Innovationen entwickeln, testen und skalieren. Damit steigt die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere in technologiegetriebenen Branchen.
Vertrauensaufbau bei Kunden und Partnern
Die öffentliche Debatte über Datenschutz und den Einfluss ausländischer Tech-Konzerne sowie Datenschutzskandale in den letzten Jahren haben das Bewusstsein für digitale Abhängigkeiten geschärft. Unternehmen, die transparent und souverän mit Daten umgehen, stärken ihr Vertrauen bei allen Stakeholdern – sowohl Partnern und Kunden. Das ist nicht nur ein Imagevorteil, sondern kann auch konkret zu besseren Geschäftsbeziehungen und höherer Kundenbindung führen.
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
Wer sich für regionale Anbieter entscheidet, stärkt damit nicht nur die eigene digitale Souveränität, sondern auch Deutschland als Wirtschaftsstandort. Wachstum und Innovation ist nur möglich, wenn Betriebe bewusst in lokale Anbieter investieren, Know-how im eigenen Land fördern und dadurch nachhaltige wirtschaftliche Ökosysteme aufbauen. Die Unterstützung regionaler Lösungen schafft Arbeitsplätze, sichert technologische Unabhängigkeit und trägt maßgeblich dazu bei, Deutschland im internationalen Wettbewerb als führenden digitalen Wirtschaftsstandort zu positionieren.
Politisches Zeitgeschehen – Warum deutsche Unternehmen jetzt digital souverän agieren können müssen
Die aktuelle geopolitische Lage, die zunehmend instabil wird, stellt deutsche Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen in Bezug auf ihre digitale Souveränität. Die wachsende Abhängigkeit von ausländischen Technologien, insbesondere aus den USA und China, birgt erhebliche Risiken. Cyberangriffe, aus China und Russland, haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Eine Studie des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass 45 Prozent der betroffenen Unternehmen die Angriffe nach China zurückverfolgen konnten, während Russland bei 39 Prozent der Fälle als Ursprungsland angegeben wurde. Diese Angriffe führen zu einem finanziellen Schaden von geschätzten 267 Milliarden Euro jährlich.
Die aktuelle Situation, geprägt von globalen Spannungen und wirtschaftlichen Herausforderungen, unterstreicht die Dringlichkeit, digitale souverän zu werden. Betriebe, die in eigene digitale Kompetenzen investieren und sich von externen Abhängigkeiten lösen, können nicht nur ihre Resilienz stärken, sondern auch ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit sichern. In einer Zeit, in der technologische Unabhängigkeit zunehmend zum entscheidenden Faktor für wirtschaftlichen Erfolg wird, ist digitale Souveränität kein Luxus und auch nicht „Nice-to-have“, sondern eine absolute Notwendigkeit.
Wie fördern Europa und Deutschland digitale Souveränität?
Auch in der Politik gewinnt digitale Souveränität zunehmend an Bedeutung.
In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen, Handelskonflikte mit China oder technologiepolitische Differenzen mit den USA ist diese Abhängigkeit ein ernstzunehmendes Risiko. Auch die jüngsten Diskussionen rund um KI-Regulierung und Plattformmonopole zeigen: Digitale Autonomie wird zunehmend zur Frage nationaler und wirtschaftlicher Sicherheit.
Die Bundesregierung sowie die Europäische Union haben erkannt, dass technologische Abhängigkeiten nicht nur wirtschaftliche Risiken bergen, sondern auch zur sicherheitspolitischen Herausforderung werden können. Die Bundesregierung hat die digitale Souveränität zum Leitmotiv ihrer Digital- und Innovationspolitik erklärt. Ziel ist es, die strategische Unabhängigkeit Europas zu stärken und die technologische Resilienz zu erhöhen.
Projekte wie GAIA-X, der European Chips Act, der EU Data Act oder EU Cloud Code of Conduct zielen darauf ab, europäische und nationale Alternativen zu stärken und strategisch wichtige digitale Infrastrukturen zurück in europäische Hand zu bringen.
European Chips Act
Der European Chips Act ist ein Maßnahmenpaket der EU-Kommission, das darauf abzielt, die Versorgungsschwierigkeiten bei Halbleitern zu bewältigen und die Produktion von Halbleitern in Europa zu erhöhen.
GAIA-X
GAIA-X ist ein Projekt zum Aufbau einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Dateninfrastruktur in Europa.
EU Data Act
Der EU Data Act ist eine zentrale Verordnung zur Stärkung der europäischen Datenwirtschaft und digitalen Souveränität. Er verpflichtet Anbieter dazu, Nutzern –B2B und B2C– fairen Zugang zu von ihnen erzeugten Daten zu gewähren, etwa aus Maschinen, IoT-Geräten oder Software.
EU Cloud Code of Conduct
Der EU Cloud Code of Conduct (CoC) ist ein Verhaltenskodex, der Cloud-Anbietern hilft, die Anforderungen der DSGVO einzuhalten. Er soll einen europaweiten Standard etablieren, mit dem Anbieter ihre Datenschutzkonformität nachweisen und Kunden zusichern können, dass ihre Daten keinem unkontrollierten staatlichen Zugriff ausgesetzt sind.
Ziel dieser Initiativen ist es, Standards zu schaffen, die Datenschutz, Transparenz, Interoperabilität und Rechtskonformität sichern und damit sichere Alternativen zu US-Diensten bieten.
Wie erreicht man digitale Souveränität?
Digitale Souveränität umfasst eine Reihe von Aspekten, die alle darauf abzielen, die Kontrolle und Unabhängigkeit über digitale Ressourcen sicherzustellen. Grundsätzlich steht sie auf 3 großen Säulen: Technologie, Unabhängigkeit, starke Partnerschaften.
Technologien
Digital souveräne Unternehmen sind auf zuverlässige und sichere Technologien und IT-Infrastrukturen angewiesen. Systeme und Daten müssen zu jeder Zeit verfügbar und zugleich ausreichend geschützt sein, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Dies erfordert eine kontinuierliche Investition in moderne Technologien, starke Sicherheitsmaßnahmen und eine effiziente Datenverwaltung.
Infrastruktur
Unternehmen sollten die Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur haben, sei es durch den Betrieb eigener Server und Rechenzentren oder einer souveränen Cloud.
Was ist eine souveräne Cloud?
Eine souveräne Cloud ist eine Cloud-Computing-Infrastruktur, die von einem Unternehmen selbst betrieben wird. Im Gegensatz zu öffentlichen Cloud-Diensten, die von großen Technologieunternehmen wie Amazon, Microsoft oder Google betrieben werden, bietet eine souveräne Cloud höhere Autonomie und gewährleistet mehr Kontrolle, Sicherheit und höheren Datenschutz.
Know-how
Die interne Expertise und das technologische Know-how sollten im Unternehmen verankert sein, um die Entwicklung und Wartung digitaler Systeme und Lösungen zu gewährleisten.
Datenkontrolle
Digital souveräne Unternehmen haben die Hoheit über ihre eigenen Daten, einschließlich der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Daten. Dies beinhaltet auch die Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und -richtlinien.
Sicherheit
Die Sicherheit der Daten ist entscheidend für die digitale Souveränität. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre Systeme vor Bedrohungen wie Cyberangriffen, Datenverlust und unautorisiertem Zugriff zu schützen, um die Integrität und Vertraulichkeit ihrer Daten zu gewährleisten.
Unabhängigkeit
Souveränität erfordert Unabhängigkeit. Digital souveräne Unternehmen sollten sich von möglichst wenig externen Einflüssen und einzelnen Anbietern abhängig machen.
Detaillierte Back-up-Strategien
Digitale souveräne Unternehmen legen großen Wert auf umfassende Back-up-Strategien. Diese Strategien umfassen detaillierte Pläne und Verfahren zur regelmäßigen Sicherung und Wiederherstellung von Daten, um die kontinuierliche Verfügbarkeit und Integrität ihrer geschäftskritischen Informationen zu gewährleisten. Dadurch können sie Daten im Ernstfall schnell wiederherstellen und Ausfallzeiten minimieren.
Eigene Lösungsentwicklung
Digital souveräne Unternehmen investieren in die interne Entwicklung von Lösungen, anstatt sich ausschließlich auf externe Anbieter zu verlassen. Durch die interne Entwicklung von Software, Systemen und Technologien können diese ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen und flexibel auf Veränderungen reagieren, ohne von anderen abhängig zu sein.
Open-Source-Technologien
In diesem Zusammenhang setzen Unternehmen verstärkt auf Open-Source-Technologien. Diese bieten nicht nur Kostenersparnisse und Flexibilität, sondern auch Transparenz und Kontrolle über den Quellcode. Durch die Nutzung von Open-Source-Software können Unternehmen die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern reduzieren und gleichzeitig von einer aktiven Community und gemeinsamer Entwicklung profitieren.
Low Code
Ein weiteres Thema in diesem Bereich sind Low Code Plattformen. Diese ermöglichen es Unternehmen kostengünstig und ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse – etwa durch Citizen Development – selbst individuelle Lösungen zu entwickeln oder bestehenden Lösungen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Starke Partnerschaften
Unabhängigkeit bedeutet jedoch nicht Isolation. Digital souveräne Unternehmen legen großen Wert auf starke Partnerschaften und Zusammenarbeit. Durch strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen können sie Synergien erzeugen, Ressourcen gemeinsam nutzen und von gemeinsamen Innovationen profitieren. Diese Partnerschaften sollten auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamen Werten und klaren Vereinbarungen basieren, um die langfristige Stabilität und den Erfolg aller Beteiligten sicherzustellen.
Technologiepartnerschaften
Kooperationen mit Technologieunternehmen ermöglichen den Zugang zu innovativen Lösungen, Fachwissen und Ressourcen, die die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien beschleunigen können.
Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften
Durch Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Universitäten oder anderen Unternehmen können digitale souveräne Unternehmen an der Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Technologien teilhaben und von Forschungsergebnissen profitieren.
Dienstleistungspartnerschaften und Beratungspartnerschaften
Partnerschaften mit Dienstleistern können dazu beitragen, den Zugang zu qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen. Auch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern ist wichtig, da sie das notwendige Know-how mitbringen, um komplexe Herausforderungen zu meistern und innovative Strategien zu entwickeln und sich erfolgreich am Markt zu positionieren.
Warum gerade CRM-Software digital souverän sein muss
CRM-Systeme (Customer-Relationship-Management) sind das digitale Herzstück jeder Kundenbeziehung. Sie enthalten hochsensible Daten – von Kontaktdaten über Kaufverhalten bis hin zu vertraulichen Gesprächsnotizen. Wenn diese Daten über Anbieter laufen, die nicht dem europäischen Datenschutz unterliegen oder ihre Server außerhalb der EU betreiben, riskieren Sie neben Bußgeldern und Schadensersatzansprüchen, die Kontrolle über eines Ihrer wertvollsten Güter: das Vertrauen Ihrer Kunden.
Ein konkretes Beispiel: Setzt ein deutsches Unternehmen auf ein US-amerikanisches CRM-System, könnten diese Daten – theoretisch – von US-Behörden eingesehen werden. Das ist nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein massives Reputationsrisiko.
Der Schlüssel liegt in der bewussten Entscheidung für europäische, datensouveräne Anbieter, die DSGVO-konform arbeiten, Serverstandorte in Europa bieten und idealerweise quelloffene oder auditierbare Software bereitstellen.
Fazit: Digitale Souveränität ist mehr als ein IT-Thema
Für deutsche Unternehmen wird digitale Souveränität zur strategischen Notwendigkeit. Sie schützt nicht nur vor rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken, sondern ist auch ein klarer Wettbewerbsfaktor.
Wer seine digitale Infrastruktur unabhängig und transparent betreibt – insbesondere in sensiblen Bereichen wie dem CRM –, bewahrt nicht nur Kontrolle, sondern auch Vertrauen und Innovationsfähigkeit.
Veröffentlicht am 15.05.2024
Aktualisiert am 30.04.2025